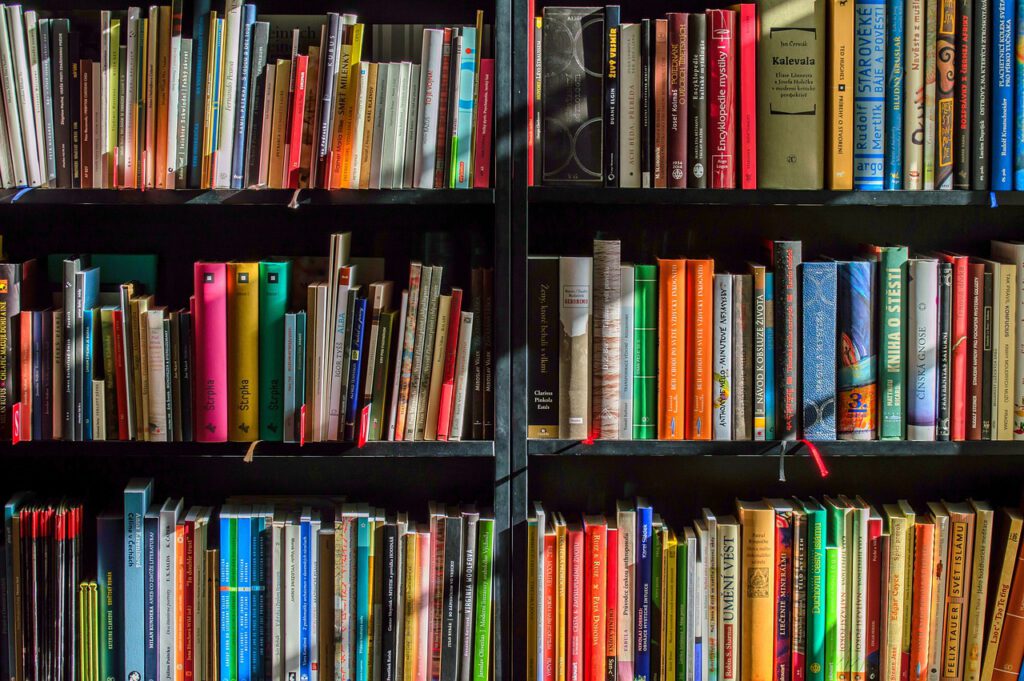Oft genug werden Haustiere ausgesetzt, sobald sie lästig werden. Nicht nur Hund oder Katze, sondern auch Süßwasserexoten. Das trägt wesentlich zur Ausbreitung invasiver Arten bei. Forschende unter Leitung des IGB haben für Deutschland die wichtigsten Risikoarten unter den aquatischen Haustieren identifiziert. Dies ist auch nötig, denn die Studie zeigt, dass 97 Prozent der in Deutschland verkauften Süßwasserarten nicht heimisch sind.
„Eine zunehmend globalisierte Welt hat die Verbreitung gebietsfremder Arten durch den schlecht regulierten internationalen Handel mit Heimtieren erleichtert. Um die Bedrohung durch invasive Arten einzudämmen, ist Prävention besonders wichtig. Dazu muss man die Risikoquellen kennen und die Arten identifizieren, die am ehesten eingeschleppt werden und sich im neuen Lebensraum etablieren können“, erklärt IGB-Forscher James W. E. Dickey, Erstautor der Studie.
Hier geht´s zur Seite des IGB für Gewässerökologie und Binnenfischerei.