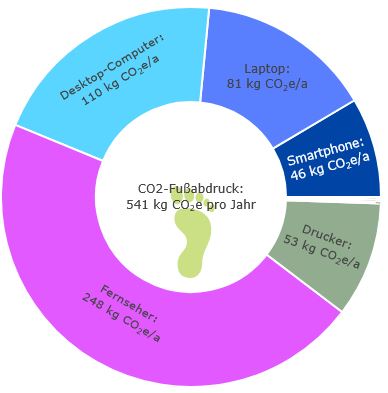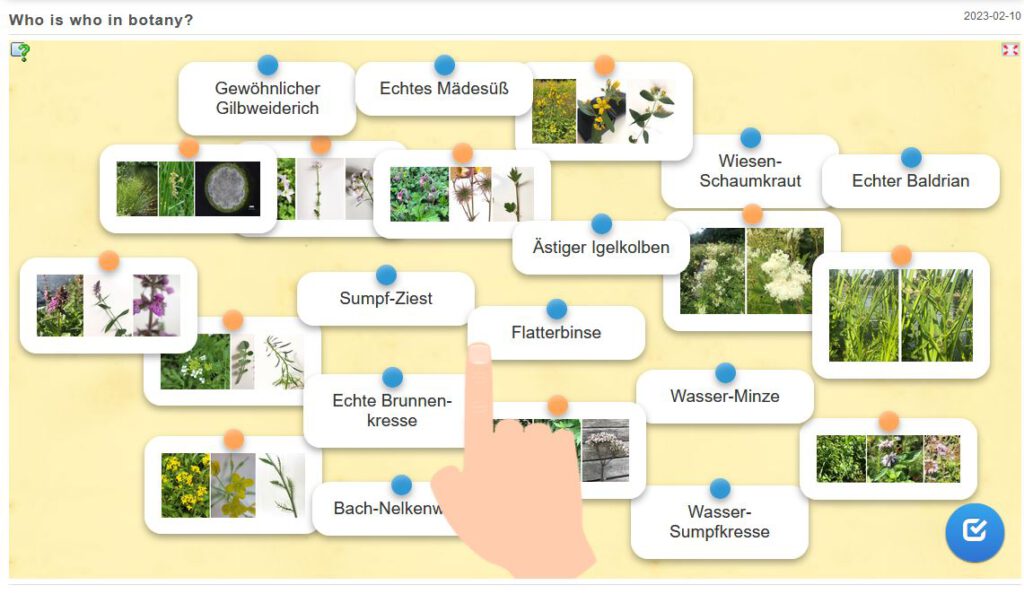Papa Uwe sitzt abends mit seinen beiden Kindern Paul und Anna am Tisch und freut sich riesig auf sein Wurstbrot. Das regt die beiden auf: „Kaum ist Mutti nicht zu Hause, mampfst du diese Stinkewurst in dich hinein.“ Uwe ist verdattert und entschließt sich, Rat zu holen.
Der 30-minütige Film ist unterhaltsam und erklärt den Zusammenhang zwischen unseren Ernährungsgewohnheiten und der Zerstörung des brasilianischen Cerrados: die artenreichste Savanne der Erde. Unser Unterrichtsmaterial „Schwere Kost für Mutter Erde“ zeigt Ihnen, wie Sie den Film in den Unterrichten integrieren können. Im Tipps und Tricks Heft sowie im WWF Akademie Kurs „Nachhaltige Ernährung“ finden Sie ergänzende Informationen und Anregungen für den Alltag.
Hier gehtt´s zur Seite des WWF: https://www.wwf.de/aktiv-werden/bildungsarbeit-lehrerservice/downloadbereich/ernaehrung