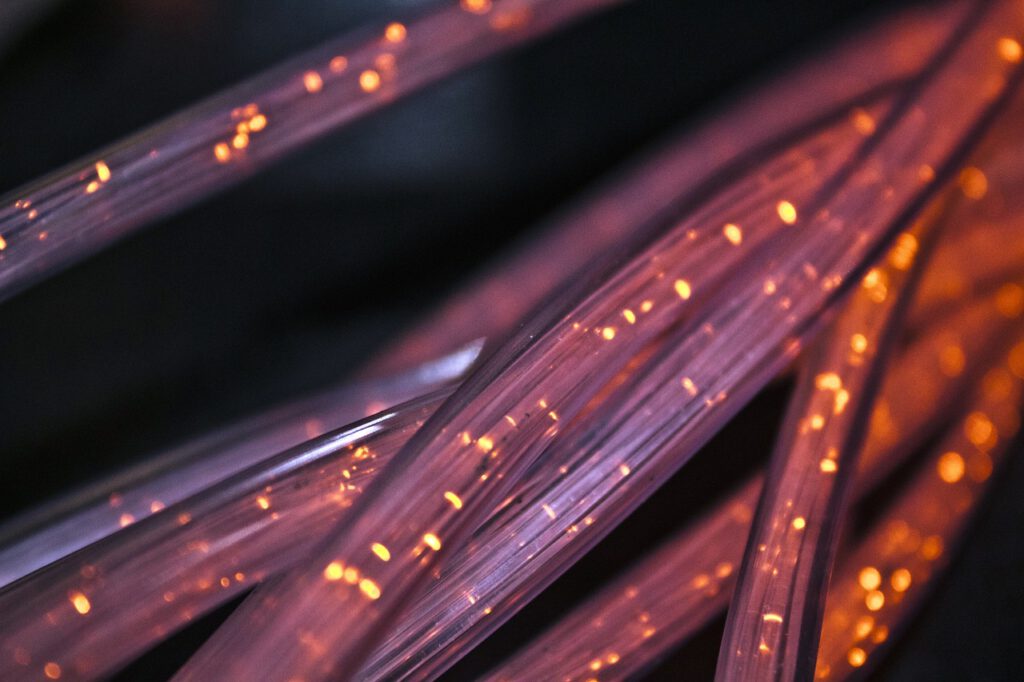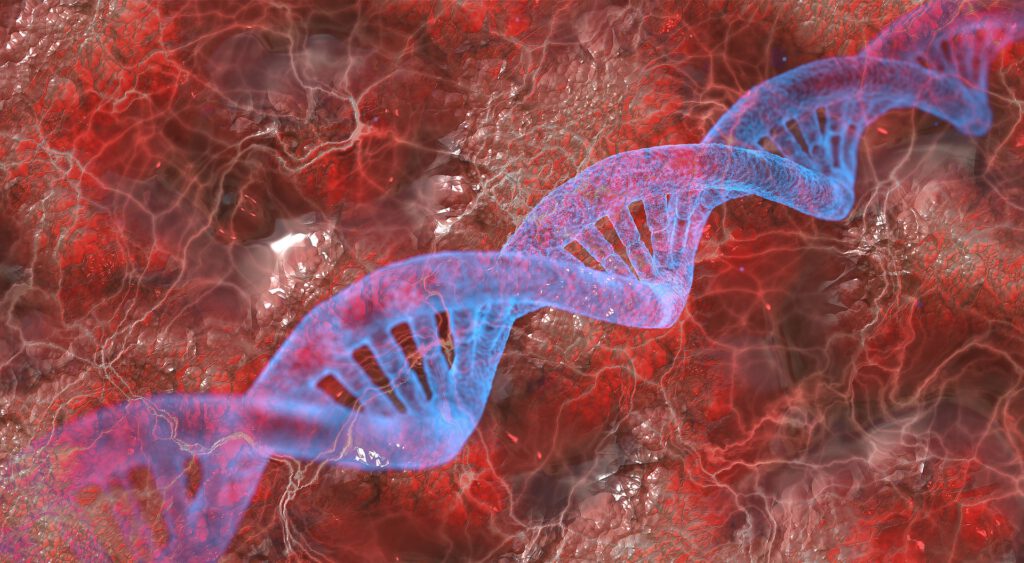Geschichten über die Heilkraft des Waldes verbreiten sich momentan rasant in Deutschland. Sogar bei den Krankenkassen gibt es schon Hinweise darauf und in Japan wird es offiziell anerkannt. Auch bei uns tauchen immer mehr Artikel und Bücher, Anleitungen und Angebote zu »Waldbaden« oder »Shinrin Yoku« sowie Ausbildungsprogramme zum Waldtherapeuten auf. Doch gibt es auch wissenschaftliche Studien, die die medizinische Wirkung des Waldes belegen können?
Ein Beitrag in der LWF aktuell der Bayrischen Forstverwaltung: https://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/service/dateien/a119_gesamt.pdf