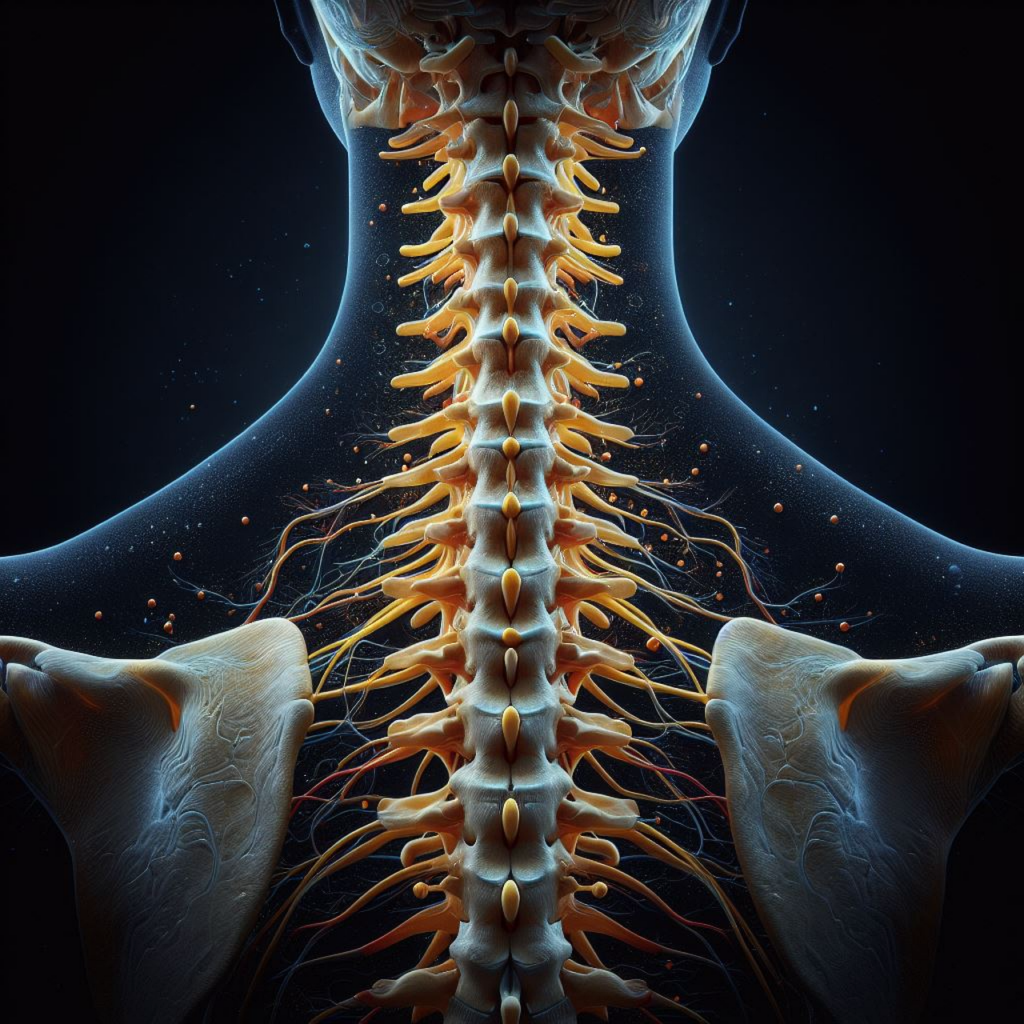Prozesse der Synchronisierung umgeben uns alltäglich, jedoch sind deren zugrunde liegende Mechanismen bis dato nicht ausreichend entschlüsselt. Forschende haben nun neue Instrumente entwickelt, um zu begreifen, wie sich menschliche und natürliche Netzwerke synchronisieren oder entkoppeln.
„Wir können sogar eine Analogie zu sozialen Medien mit ihrem Echokammer-Phänomen herstellen“, sagt Mitautor Professor Jürgen Jost, dessen Forschungsgruppe sich außerdem mit der Dynamik sozialer Netzwerke beschäftigt. „Hier sehen wir Subgruppen, die ihre eigenen Botschaften durch konvergente Verbreitung innerhalb ihrer eigenen Gruppe verstärken, aber nicht unbedingt mit der breiteren Bevölkerung in Einklang bringen.“ so der Direktor des Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig.
Den Artikel finden Sie auf der Seite des MPI Leibzig.