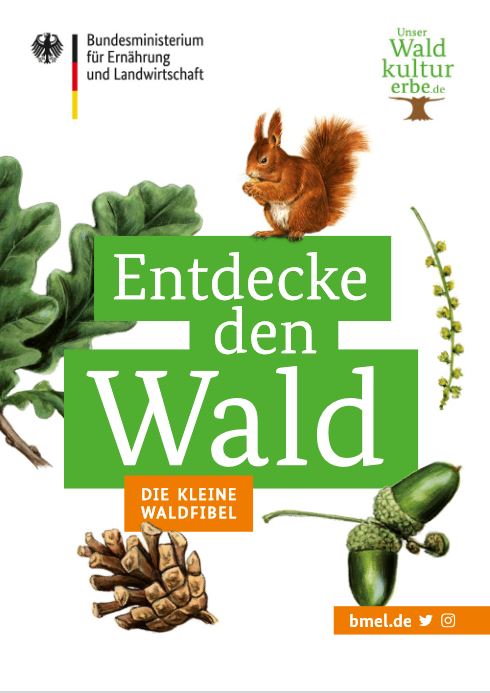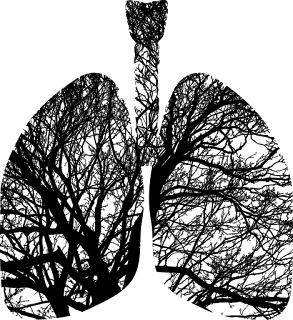Mit unseren Modulen für die Sekundarstufe, getrennt empfohlen für die Klassen 5 bis 7, 8 bis 10 und 11 bis 13 können Lehrerinnen und Lehrer fächerverbindenden und projektorientierten Unterricht gestalten, und auf diese Weise Verständnis und den bewussten Umgang mit unseren Gewässern insbesondere unter den stetig zunehmenden Herausforderungen des Klimawandels zu bewirken. Darüber hinaus werden neben den Modulen zu den Lebensräumen für viele Tier- und Pflanzenarten, welche einen Beitrag zur Biodiversität leisten und die Widerstandsfähigkeit der Bäche und ihrer Umgebung gegen die Folgen des Klimawandels stärken, weitere Themen angeboten.
Die Materialien finden Sie auf der Seite der Klimabildung Hessen: https://www.klimabildung-hessen.de/ein-bach-ist-mehr-als-wasser.html