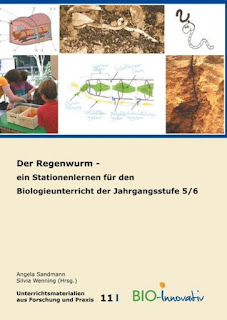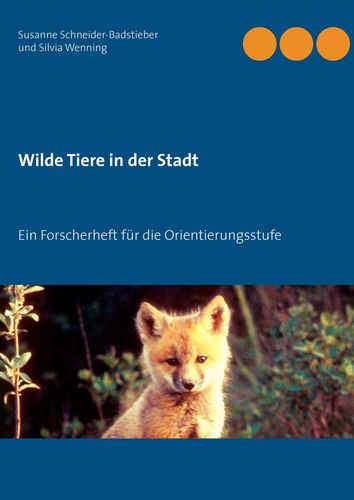Der Goldene oder auch schreckliche Pfeilgiftfrosch ist eines der giftigsten Tiere der Welt. Mit dem Gift eines Frosches kann man 10000 Mäuse oder 10 Menschen töten.
Einige indigene Völker Südamerikas nutzen sein Gift, um ihre Pfeile zu präparieren.
In Gefangenschaft verlieren die Tiere ihre Giftigkeit, da sie Alkaloide spezieller tropischer Futterinsekten benötigen, um ihr Gift, das Batrachotoxin, zu synthetisieren.
Nach ca. 2 Jahren haben die Frösche alles Gift verloren. Die Nachzuchten sind völlig ungiftig.
Batrachotoxin verursacht bei kleinsten Verletzung der Haut Krampfzustände, da es die die Inaktivierung der Natriumkanäle hemmt.
Die Forscherin Sho-Ya Wang der University of New York untersuchte, warum sich die Pfeligiftfrösche nicht selbst vergiften. Das Brachotoxin setzt sich bei anderen Organismen an die geöffneten Natriumkanäle. An den Natriumkanälen des Pfeilgiftfrosches kann es sich nicht festsetzen.
Frau Wang konnte nachweisen, dass es 5 Mutationen an den Natriumkanälen des Pfeilgiftfrosches gibt. „Wir haben alle fünf Mutationen einzeln getestet und dabei herausgefunden, dass nur eine einzige davon für die Unempfindlichkeit gegen das Gift nötig ist.“ Eine einzelne veränderte Aminosäure ist der Trick des Pfeilgiftfrosches. Ein schönes Beispiel für den Neurobiologieunterricht.
Hier geht´s zum Artikel.
Übirgens bildet der Kugelfisch ein Gegengift für das Bratrachotoxin. Sein Tetrodotoxin blockiert die Natriumkanäle.